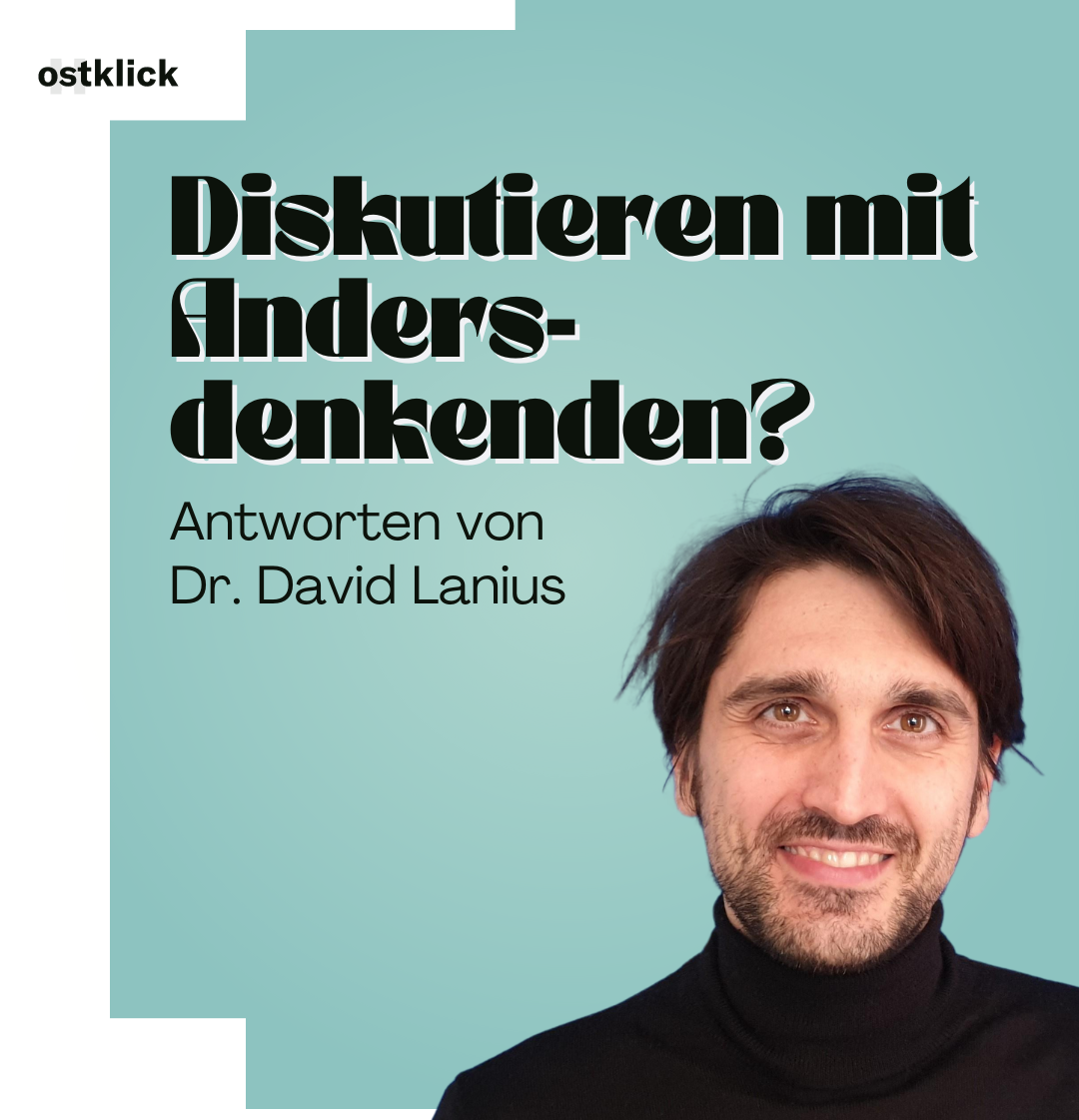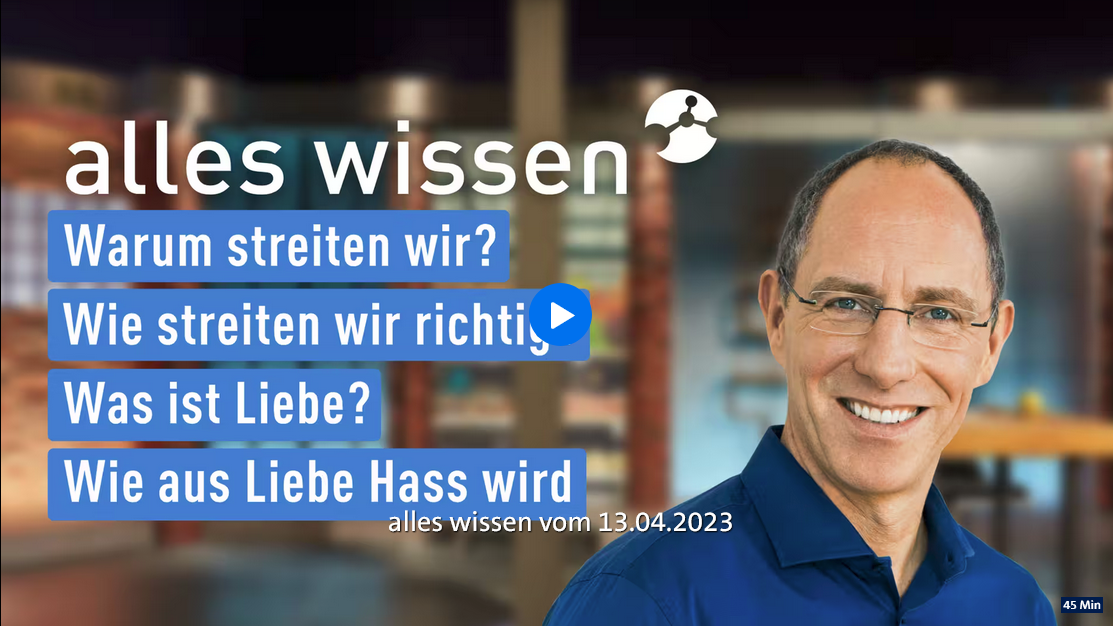Argumentieren lernen mit Toulmin?
Zusammen mit Kathrin Kazmaier, Dominik Balg und David Löwenstein habe ich einen Sammelband herausgegeben, der heute erschienen ist. Er bietet eine interdisziplinäre und kritisch fundierte Auseinandersetzung mit dem Toulmin-Schema als Modell der Argumentationsanalyse und -förderung in Schule und Hochschule.
Das Toulmin-Schema ist in vielen Fachdidaktiken etabliert und dient dort als Werkzeug, um Argumentationsstrukturen sichtbar zu machen und argumentative Kompetenzen gezielt zu fördern. Zugleich zeigt sich eine wachsende Kluft zwischen seiner prominenten Rolle in der Unterrichtspraxis und der kritischen Bewertung in der aktuellen argumentationstheoretischen Debatte. Vor diesem Hintergrund versammelt der Band Beiträge aus der Philosophie-, Deutsch- und Geographiedidaktik, die das Toulmin-Schema aus verschiedenen fachlichen Blickwinkeln beleuchten, seine Potenziale und Grenzen analysieren sowie Alternativen aufzeigen.
Open-Access und frei herunterladbar auf wbv.de.
Tiefe Gräben – Wenn Politik Freundschaften und Familien zerreißt
In der DLF-Sendung „Lebenszeit“ habe ich über politische Streitgespräche in Familien und Freundschaften gesprochen. Nachzuhören in der DLF-Mediathek.
Die Konstruktion von Wahrheit
Täuschend echte Daten, Deepfakes und manipulierte Nachrichten verleihen Falschinformationen den Anschein von Glaubwürdigkeit, während gesicherte Fakten infrage gestellt werden. Wie trennen wir Vermutung, Wahrscheinlichkeiten und gesichertes Wissen? Woran können wir noch glauben? Wer bestimmt, was wirklich wahr ist und wie schützen wir unser Wissen und unsere (künstlerischen) Werke? Die Wissenschaft gerät unter Druck, wenn die Gesellschaft das Vertrauen in Institutionen und Medien verliert.
Gibt es (noch) eine gemeinsame Wirklichkeit?
Die Salzburger Hochschulen Entwicklungsimpulse laden ein:
- Wann? Mittwoch, 14. Mai 2025, 17:30 Uhr
- Wo? Universität Mozarteum, Kleines Studio, Mirabellplatz 1, 5020 Salzburg
- Wer? Daniela Schuster, Bernhard Rausch, Clemens Havas, Claudia Lehmann und ich
Demokratische Streitkultur für die digitale Öffentlichkeit
Die „Kulturgespräche 2025“ vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) haben ein spannendes Programm zu demokratischer Streitkultur unter anderem mit Paulina Fröhlich, Christian Welzel und mir.
Im Interview mit Ostklick
Um in unserer vielfältigen Gesellschaft Meinungen zu bilden, Annäherungen zu finden und Kompromisse zu schließen, sind Diskussionen und Austausch unerlässlich. Doch wie kann ein „guter“ Streit gelingen? Wo liegen die Schwierigkeiten und welche Rolle spielt Social Media dabei? Darüber habe ich mit Ostklick gesprochen.
Auf dem 15. Bundeskongress Politische Bildung in der Sektion „(Ent-)Demokratisierung“
Ist die Demokratie in der Krise oder hat sie sich lediglich neuen Herausforderungen zu stellen, weil sie als dynamisches System einem ständigen Wandel unterliegt? Diese und weitere Fragen habe ich mit Veith Selk, Michael Zürn, Elke Seefried und Alexander Wohnig in Weimar diskutiert.
Warum streiten wir?
Warum gelingt es uns oft nicht, Konflikte konstruktiv zu führen? Ist Streit immer schlecht? Und wie könnte man besser streiten?
Im Kern kommt es auf die Haltung an, und darauf, dass man sich die richtigen Ziele setzt. Warum streiten wir also?
Hier im Interview bei „Alles wissen“ vom HR am 13. April 2023 (in der ARD-Mediathek).

Warum Konflikte so wichtig sind
Ob privat oder bei der Arbeit, auf Twitter oder in Talkshows: Nirgendwo geht es immer harmonisch zu. Aber warum sind Konflikte wichtig? Und wie streiten wir richtig? Fokus sind dabei persönliche Konflikte.
Damit beschäftigt sich ein neuer Artikel von galileo.tv mit einem Interview mit mir. Es geht um diese Fragen: Ist Streit gut oder schlecht? Warum streiten Menschen überhaupt? Warum fliegen selbst bei Liebespaaren die Fetzen? Was schadet einem Streit? Welche Vor- und Nachteile hat Streiten? Was macht einen guten Streit aus? Wie verhindert man, dass sich die Fronten verhärten?
Zudem gibt es eine Übersicht über die wichtigsten Gründe für Streit und 11 Tipps für besseres Streiten.
Debattieren auf Englisch als Ansatz für mehr Demokratie und Teilhabe in der Schule
Nicht erst seit Erstarken der Verschwörungserzählungen und sog. Querdenker im Zuge der Coronapandemie ist deutlich, dass der gesellschaftliche Konsens über die Grundwerte, die unsere Demokratie tragen, nicht von allen Menschen geteilt wird. Rechtsextremes, völkisches und radikalreligiöses Gedankengut und Handeln findet eine besorgniserregende Verbreitung – im Internet und in der analogen Öffentlichkeit. Diese Tendenzen in allen Teilen der Gesellschaft spiegeln sich auch im Raum Schule.
Schule muss darauf reagieren und tut es auch: Nicht umsonst formuliert das Berliner Schulgesetz den demokratiefördernden Auftrag von Schule, Schüler:innen zu befähigen, „das staatliche und gesellschaftliche Leben auf der Grundlage der Demokratie (…) zu gestalten“ (§1 Berliner Schulgesetz), an allererster Stelle. In der Praxis bedeutet dies, dass die Schüler:innen im Politikunterricht, aber auch in vielen weiteren Fächern, u. A. dem Fremdsprachenunterricht, lernen, was Demokratie und demokratisches Handeln bedeuten.
Der Argumentations- und Urteilskompetenz von Schüler:innen kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Zu kontroversen Themen einen Standpunkt entwickeln und für diesen eintreten zu können, ist eine Kernkompetenz, auf die nicht nur unsere Gesellschaft als Ganzes, sondern auch jede:r Heranwachsende für sich angewiesen ist. Gerade das Debattieren in der Lingua franca und Brückensprache Englisch erscheint in Zeiten zunehmender Globalisierung und Mehrsprachigkeit als wichtige Zukunftsressource und Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, insbesondere in multikulturellen und vielsprachigen Metropolen wie Berlin.
Im Rahmen dieser Fortbildungsreihe gebe ich einen Vortrag zur Förderung von Argumentations- und Urteilskompetenz durch Debattieren im Unterricht.
Anmeldung und mehr Informationen zur Veranstaltungsreihe hier:
Argumentieren in der Schule: Fächerübergreifende Perspektiven
Das Netzwerk „Argumentieren in der Schule“ richtet auch im Rahmen seines driiten Arbeitstreffens einen öffentlichen Workshop aus, der unter dem Titel „Fachdidaktik des Argumentierens: Fächerübergreifende Perspektiven“ am 19. und 20. September 2022 an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz stattfindet.
Das Formulieren, Analysieren und Bewerten von Argumenten steht als Kernkompetenz freier und kritischer Bürger*innen zurecht im Zentrum der Bildungsziele von Universitäten und Schulen. Diese Kompetenzen haben einen wesentlichen Anteil an dem im „Dresdener Konsens“ formulierten Ziel der Stärkung einer ganzheitlich verstandenen Urteilskraft. Die Philosophie steht dabei in einer besonderen Verantwortung, solche argumentativen Kompetenzen zu fördern, da sie die systematische kritische Reflexion des Begründens und Argumentierens, die Argumentationstheorie, beinhaltet. Doch zugleich ist eine interdisziplinäre Zusammenarbeit mit anderen Fächern und Fachdidaktiken erforderlich, um das Argumentieren in der Schule breit und nachhaltig zu stärken.
Programm
Der anstehende Workshop wird ausgehend vom Philosophie- und Ethikunterricht das Argumentieren als ein fächerübergreifendes Kompetenz- und Themenfeld in den Fokus nehmen. In zwei Keynote-Vorträgen werden Prof. Dr. Sara Rezat (Paderborn) Perspektiven aus der Fachdidaktik des Deutschunterrichts und Prof. Dr. Andreas Petrik (Halle) Perspektiven aus der Politikdidaktik einbringen. Der Workshop richtet sich an alle, die sich für das Argumentieren in der Schule interessieren, von Lehrpersonen an Schulen bis zu Lehrenden und Forschenden in der Fachdidaktik oder der Argumentationstheorie.
Montag, 19. September 2022
- ab 14:30: Informelles Zusammenkommen
- 15:00-16:00: Anne Burkard
Ein Fortbildungskonzept mit Begleitforschung zur Förderung argumentativer Fähigkeiten im Philosophie- und Ethikunterricht - 16:15-17:15: Dominik Balg
Gewusst-wie oder Gewusst-wann? Argumentative Metakompetenzen und die Grenzen argumentativer Auseinandersetzungen - 17:30-19:00: Andreas Petrik
Die Argumentationsanalyse als qualitative Methode zur Rekonstruktion der Urteils- und Konfliktlösungskompetenz
Dienstag, 20. September 2022
- 9:00-10:00: Marie-Luise Raters
Ethisches Argumentieren im Selbst-Studium? - 10:15-11:15: Stefan Descher
Argumentieren für Literaturinterpretationen: Beobachtungen zur fachwissenschaftlichen Praxis und Überlegungen zur didaktischen Vermittlung - 11:30-12:30: Katrin Schultze
Argumentieren im Englischunterricht - Mittagspause
- 14:00-15:00: Karoline Kucharzyk
Die Bewertung bewerten? Eine Analysematrix zur Raumbewertung im Fach Geographie für die Oberstufe - 15:30-17:00: Sara Rezat
Schriftliches Argumentieren – Erwerb und Förderung aus deutschdidaktischer Perspektive
Registrierung
Alle Interessierten sind herzlich zur Teilnahme eingeladen und werden gebeten, sich bis zum 1. September per E-Mail an dlanius@uni-mainz.de anzumelden.
Organisation und Dank
Der Workshop wird organisiert von David Löwenstein und mir. Für die großzügige Finanzierung des Workshops im Rahmen des Netzwerks „Argumentieren in der Schule“ danken wir der Deutschen Forschungsgemeinschaft, für die Übernahme von Verpflegungskosten, der Gesellschaft für Analytische Philosophie.
Hier finden Sie das Programm als PDF.